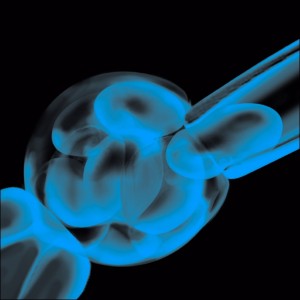Die Wissenschaftskommission des Ständerats will Embryonen-Tests für alle künstlichen Befruchtungen zulassen. insieme befürchtet einen Dammbruch.
Mit acht gegen drei Stimmen hat sich die Wissenschaftskommission des Ständerats (WBK-S) gestern dafür ausgesprochen, bei allen künstlichen Befruchtungen so genannte Aneuploidie-Screenings zuzulassen. Das heisst, es soll gezielt und systematisch nach Embryonen mit einem „abnormen“ Chromosomensatz gesucht werden dürfen.
Nur Embryonen mit einem normalen Chromosomensatz werden anschliessend in die Gebärmutter der Frau eingepflanzt, während solche mit fehlerhaftem Chromosomensatz wie Trisomie 21 vernichtet werden.
6000 Tests pro Jahr
Bisher sollte die PID nur in eng definierten Fällen angewendet werden dürfen, nämlich bei Paaren, die damit rechnen müssen, ihren Kindern eine schwere Erbkrankheit weiterzugeben. Der Bundesrat rechnete mit 50 bis 100 Fällen pro Jahr.
Wenn nun aber auch Paare, die an Unfruchtbarkeit leiden, die PID anwenden dürfen, käme es zu einer massiven Ausweitung der Embryonen-Tests auf 6000 pro Jahr, so viele künstliche Befruchtungen werden in der Schweiz jährlich durchgeführt.
Ethische Bedenken
Insieme hat seit Beginn der Debatte um die Legalisierung der PID grosse Bedenken geäussert und klare Schranken im Sinne des Bundesrates gefordert. Dieser hatte die Aneuploidie-Screenings aus ethischen Überlegungen verworfen. Denn es sei wissenschaftlich nicht erwiesen, dass dieses Verfahren die Erfolgschancen von Behandlungen der Unfruchtbarkeit tatsächlich erhöhe.
Ausserdem führe die Zulassung der Screenings zu „einer erheblichen Abschwächung des Embryonenschutzes“. Durch die massive Ausweitung der Tests würde die PID dermassen etabliert, dass gesellschaftlicher Druck auf Paare entstehen könnte. Der Bundesrat warnt explizit vor „eugenischen Entwicklungen“.
Selbstbestimmte Entscheidung wird schwieriger
Insieme kritisiert, dass die PID keinen therapeutischen, sondern einen rein selektiven Zweck hat. Das Verfahren zwingt zur Unterscheidung zwischen lebenswertem und lebensunwertem Leben. Und damit zur Abwertung und Diskriminierung von Menschen, die mit einer Behinderung leben, die technisch vermeidbar gewesen wäre.
Der Erwartungsdruck an angehende Eltern steigt, alles technisch Machbare zu unternehmen, um eine Behinderung zu vermeiden. Eine systematische Suche nach Anomalien wird zur Selbstverständlichkeit. Frei und selbstbestimmt zu entscheiden wird für werdende Eltern damit schwieriger.